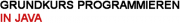Lösungsvorschläge
Grundkurs Programmieren in Java (9. Auflage, 2024)
Hier finden Sie Lösungsvorschläge zu den Übungsaufgaben. Suchen Sie einfach anhand des Inhaltsverzeichnisses die Stelle, an der sich die Aufgabe im Buch befindet, und navigieren Sie über den Link in den entsprechenden Teil des Dokuments.
Inhaltsverzeichnis
-
1 Einige Grundbegriffe aus der Welt des Programmierens
-
1.1 Computer, Software, Informatik und das Internet
-
1.2 Was heißt Programmieren?
-
1.3 Welche Werkzeuge brauchen wir?
-
-
2 Aller Anfang ist schwer
-
2.1 Installation der Entwicklungswerkzeuge
-
2.1.1 Rundum sorglos mit Eclipse
-
2.1.2 Traditionelle JDK-Installation
-
-
2.2 Mein erstes Programm
-
2.2.1 Quellcode eingeben, übersetzen und ausführen
-
2.2.2 Das Programmgerüst
-
2.2.3 Verwendung von Variablen
-
2.2.4 Formeln, Ausdrücke, Zuweisungen
-
2.2.5 „Auf den Schirm!“
-
2.2.6 Die Kurzversion zum Vergleich
-
-
-
-
3 Grundlagen der Programmierung in Java
-
3.1 Grundelemente eines Java-Programms
-
3.1.1 Kommentare
-
3.1.2 Bezeichner und Namen
-
3.1.3 Literale
-
3.1.4 Reservierte Wörter, Schlüsselwörter
-
3.1.5 Trennzeichen
-
3.1.6 Interpunktionszeichen
-
3.1.7 Operatorsymbole
-
3.1.8 import-Anweisungen
-
3.1.9 Zusammenfassung
-
-
-
3.2 Erste Schritte in Java
-
3.2.1 Grundstruktur eines Java-Programms
-
3.2.2 Ausgaben auf der Konsole
-
3.2.3 Eingaben von der Konsole
-
3.2.4 Schöner programmieren in Java
-
3.2.5 Zusammenfassung
-
-
-
3.3 Einfache Datentypen
-
3.3.1 Ganzzahlige Datentypen
-
3.3.1.1 Literalkonstanten in anderen Zahlensystemen
-
3.3.1.2 Unterstrich als Trennzeichen in Literalkonstanten
-
-
3.3.2 Gleitkommatypen
-
3.3.3 Der Datentyp char für Zeichen
-
3.3.4 Der Datentyp String für Zeichenketten
-
3.3.5 Der Datentyp boolean für Wahrheitswerte
-
3.3.6 Implizite und explizite Typumwandlungen
-
3.3.7 Zusammenfassung
-
-
-
3.4 Der Umgang mit einfachen Datentypen
-
3.4.1 Variablen
-
3.4.2 Operatoren und Ausdrücke
-
3.4.2.1 Arithmetische Operatoren
-
3.4.2.2 Bitoperatoren
-
3.4.2.3 Zuweisungsoperator
-
3.4.2.4 Vergleichsoperatoren und logische Operatoren
-
3.4.2.5 Inkrement- und Dekrementoperatoren
-
3.4.2.6 Priorität und Auswertungsreihenfolge der Operatoren
-
-
3.4.3 Allgemeine Ausdrücke
-
3.4.3.1 Reihenfolge der Operationen in Ausdrücken
-
3.4.3.2 Potenzielle Probleme bei der Auswertung von Ausdrücken
-
-
3.4.4 Ein- und Ausgabe
-
3.4.4.1 Statischer Import der IOTools-Methoden
-
-
3.4.5 Zusammenfassung
-
-
-
3.5 Anweisungen und Ablaufsteuerung
-
3.5.1 Anweisungen
-
3.5.2 Blöcke und ihre Struktur
-
3.5.3 Entscheidungsanweisungen
-
3.5.3.1 Die if-Anweisung
-
3.5.3.2 Die switch-Anweisung
-
3.5.3.3 Die vereinfachte switch-Anweisung
-
3.5.3.4 Switch-Ausdrücke
-
-
3.5.4 Wiederholungsanweisungen, Schleifen
-
3.5.4.1 Die for-Anweisung
-
3.5.4.2 Vereinfachte for-Schleifen-Notation
-
3.5.4.3 Die while-Anweisung
-
3.5.4.4 Die do-Anweisung
-
3.5.4.5 Endlosschleifen
-
-
3.5.5 Sprungbefehle und markierte Anweisungen
-
3.5.6 Zusammenfassung
-
-
-
-
4 Referenzdatentypen
-
4.1 Felder (Arrays)
-
4.1.1 Was sind Felder?
-
4.1.2 Deklaration, Erzeugung und Initialisierung von Feldern
-
4.1.3 Felder unbekannter Länge
-
4.1.4 Referenzen
-
4.1.5 Ein besserer Terminkalender
-
4.1.6 Mehrdimensionale Felder
-
4.1.7 Mehrdimensionale Felder unterschiedlicher Länge
-
4.1.8 Vorsicht, Falle: Kopieren von mehrdimensionalen Feldern
-
4.1.9 Vereinfachte for-Schleifen-Notation
-
4.1.10 Zusammenfassung
-
-
-
4.2 Klassen
-
4.2.1 Willkommen in der ersten Klasse!
-
4.2.2 Komponentenzugriff bei Objekten
-
4.2.3 Ein erstes Adressbuch
-
4.2.4 Klassen als Referenzdatentyp
-
4.2.5 Felder von Klassen
-
4.2.6 Vorsicht, Falle: Kopieren von geschachtelten Referenzdatentypen
-
4.2.7 Zusammenfassung
-
-
-
-
5 Methoden, Unterprogramme
-
5.1 Methoden
-
5.1.1 Was sind Methoden?
-
5.1.2 Deklaration von Methoden
-
5.1.3 Parameterübergabe und Ergebnisrückgabe
-
5.1.4 Aufruf von Methoden
-
5.1.5 Überladen von Methoden
-
5.1.6 Variable Argumentanzahl bei Methoden
-
5.1.7 Vorsicht, Falle: Referenzen als Parameter
-
5.1.8 Sichtbarkeit und Verdecken von Variablen
-
5.1.9 Zusammenfassung
-
-
-
5.2 Rekursiv definierte Methoden
-
5.2.1 Motivation
-
5.2.2 Gute und schlechte Beispiele für rekursive Methoden
-
5.2.3 Zusammenfassung
-
-
5.3 Die Methode main
-
5.3.1 Kommandozeilenparameter
-
5.3.2 Anwendung der vereinfachten for-Schleifen-Notation
-
5.3.3 Zusammenfassung
-
-
-
5.4 Methoden aus anderen Klassen aufrufen
-
5.4.1 Klassenmethoden
-
5.4.2 Die Methoden der Klasse Math
-
5.4.3 Statischer Import
-
-
5.5 Methoden von Objekten aufrufen
-
5.5.1 Instanzmethoden
-
5.5.2 Die Methoden der Klasse String
-
-
-
-
6 Die objektorientierte Philosophie
-
6.1 Die Welt, in der wir leben
-
6.2 Programmierparadigmen – Objektorientierung im Vergleich
-
6.3 Die vier Grundpfeiler objektorientierter Programmierung
-
6.3.1 Generalisierung
-
6.3.2 Vererbung
-
6.3.3 Kapselung
-
6.3.4 Polymorphie
-
6.3.5 Weitere wichtige Grundbegriffe
-
-
6.4 Modellbildung – von der realen Welt in den Computer
-
6.4.1 Grafisches Modellieren mit UML
-
6.4.2 Entwurfsmuster
-
-
6.5 Zusammenfassung
-
-
-
7 Der grundlegende Umgang mit Klassen
-
7.1 Vom Referenzdatentyp zur Objektorientierung
-
7.2 Instanzmethoden
-
7.2.1 Zugriffsrechte
-
7.2.2 Was sind Instanzmethoden?
-
7.2.3 Instanzmethoden zur Validierung von Eingaben
-
7.2.4 Instanzmethoden als erweiterte Funktionalität
-
-
7.3 Statische Komponenten einer Klasse
-
7.3.1 Klassenvariablen und -methoden
-
7.3.2 Klassenkonstanten
-
-
7.4 Instanziierung und Initialisierung
-
7.4.1 Konstruktoren
-
7.4.2 Überladen von Konstruktoren
-
7.4.3 Der statische Initialisierer
-
7.4.4 Der Mechanismus der Objekterzeugung
-
-
7.5 Zusammenfassung
-
-
-
8 Vererbung und Polymorphie
-
8.1 Wozu braucht man Vererbung?
-
8.1.1 Aufgabenstellung
-
8.1.2 Analyse des Problems
-
8.1.3 Ein erster Ansatz
-
8.1.4 Eine Klasse für sich
-
8.1.5 Stärken der Vererbung
-
8.1.6 Vererbung verhindern durch final
-
-
-
8.2 Die super-Referenz
-
8.3 Überschreiben von Methoden und Variablen
-
8.3.1 Dynamisches Binden
-
8.3.2 Überschreiben von Methoden verhindern durch final
-
-
8.4 Die Klasse Object und der Umgang mit instanceof und @Override
-
8.4.1 Methoden der Klasse Object sinnvoll überschreiben
-
8.4.2 Hilfe beim Überschreiben: Die Annotation @Override
-
8.4.3 Der Operator instanceof und das Pattern-Matching
-
8.4.4 Das Pattern-Matching für switch
-
-
-
8.6 Abstrakte Klassen und Interfaces
-
8.6.1 Einsatzszenarien am Beispiel
-
8.6.2 Abstrakte Klassen im Detail
-
8.6.3 Interfaces im Detail
-
-
8.7 Interfaces mit Default-Methoden und statischen Methoden
-
8.7.1 Deklaration von Default-Methoden
-
8.7.2 Deklaration von statischen Methoden
-
8.7.3 Auflösung von Namensgleichheiten bei Default-Methoden
-
8.7.4 Interfaces und abstrakte Klassen im Vergleich
-
-
8.8 Weiteres zum Thema Objektorientierung
-
8.8.1 Erstellen von Paketen
-
8.8.2 Zugriffsrechte
-
8.8.3 Innere Klassen
-
8.8.4 Anonyme Klassen
-
-
8.9 Zusammenfassung
-
-
-
9 Exceptions und Errors
-
9.1 Eine Einführung in Exceptions
-
9.1.1 Was ist eine Exception?
-
-
9.1.3 Abfangen von Exceptions
-
9.1.4 Ein Anwendungsbeispiel
-
9.1.5 Die RuntimeException
-
-
-
9.2 Exceptions für Fortgeschrittene
-
9.2.1 Definieren eigener Exceptions
-
-
9.2.3 Vererbung und Exceptions
-
9.2.4 Vorsicht, Falle!
-
9.2.5 Der finally-Block
-
9.2.6 Die Klassen Throwable und Error
-
9.2.7 Zusammenfassung
-
-
-
9.3 Assertions
-
9.3.1 Zusicherungen im Programmcode
-
9.3.2 Ausführen des Programmcodes
-
9.3.3 Zusammenfassung
-
-
9.4 Mehrere Ausnahmetypen in einem catch-Block
-
9.5 Ausblick: try-Block mit Ressourcen
-
-
10 Fortgeschrittene Themen der objektorientierten Programmierung
-
10.1 Aufzählungstypen
-
10.1.1 Deklaration eines Aufzählungstyps
-
10.1.2 Instanzmethoden der enum-Objekte
-
10.1.3 Selbstdefinierte Instanzmethoden für enum-Objekte
-
-
-
10.2 Generische Datentypen
-
10.2.1 Herkömmliche Generizität
-
10.2.2 Generizität durch Typ-Parameter
-
10.2.3 Einschränkungen der Typ-Parameter
-
10.2.4 Wildcards
-
10.2.5 Bounded Wildcards
-
10.2.6 Generische Methoden
-
10.2.7 Verkürzte Notation bei generischen Datentypen
-
10.2.8 Ausblick
-
-
-
10.3 Sortieren von Feldern und das Interface Comparable
-
10.3.1 Einsatz der Klasse Arrays
-
10.3.2 Implementierung des Interface Comparable
-
-
-
10.4 Versiegelte Klassen und Interfaces
-
10.4.1 Der Mechanismus der Versiegelung
-
10.4.2 Versiegelung am Beispiel von Klassen
-
10.4.3 Versiegelung am Beispiel mit einem Interface
-
10.4.4 Hilfreiche Konsequenzen für das Pattern-Matching
-
-
-
10.5 Records
-
10.5.1 Motivation für die Nutzung von Records
-
10.5.2 Records im Detail
-
10.5.2.1 Regeln zur Vererbung für Records
-
10.5.2.2 Mögliche Ergänzungen von Records
-
-
10.5.3 Records und das Pattern-Matching
-
-
-
-
11 Einige wichtige Hilfsklassen
-
11.1 Die Klasse StringBuffer
-
11.1.1 Arbeiten mit String-Objekten
-
11.1.2 Arbeiten mit StringBuffer-Objekten
-
-
-
11.2 Die Wrapper-Klassen (Hüll-Klassen)
-
11.2.1 Arbeiten mit „eingepackten“ Daten
-
11.2.2 Aufbau der Wrapper-Klassen
-
11.2.3 Ein Anwendungsbeispiel
-
11.2.4 Automatische Typwandlung für die Wrapper-Klassen
-
-
-
11.3 Die Klassen BigInteger und BigDecimal
-
11.3.1 Arbeiten mit langen Ganzzahlen
-
11.3.2 Aufbau der Klasse BigInteger
-
-
11.3.4 Arbeiten mit langen Gleitkommazahlen
-
11.3.5 Aufbau der Klasse BigDecimal
-
11.3.6 Viele Stellen von Nullstellen gefällig?
-
-
-
11.4 Die Klasse DecimalFormat
-
11.4.1 Standardausgaben in Java
-
11.4.2 Arbeiten mit Format-Objekten
-
11.4.3 Vereinfachte formatierte Ausgabe
-
-
-
11.5 Die Klassen Date und Calendar
-
11.5.1 Arbeiten mit „Zeitpunkten“
-
11.5.2 Auf die Plätze, fertig, los!
-
11.5.3 Spezielle Calendar-Klassen
-
11.5.4 Noch einmal: Zeitmessung
-
-
-
11.6 Die Klassen SimpleDateFormat und DateFormat
-
11.6.1 Arbeiten mit Format-Objekten für Datum/Zeit-Angaben
-
-
-
11.7 Die Collection-Klassen
-
11.7.1 „Sammlungen“ von Objekten – der Aufbau des Interface Collection
-
11.7.2 „Sammlungen“ durchgehen – der Aufbau des Interface Iterator
-
11.7.3 Mengen
-
11.7.3.1 Das Interface Set
-
11.7.3.2 Die Klasse HashSet
-
11.7.3.3 Das Interface SortedSet
-
11.7.3.4 Die Klasse TreeSet
-
-
11.7.4 Listen
-
11.7.4.1 Das Interface List
-
11.7.4.2 Die Klassen ArrayList und LinkedList
-
11.7.4.3 Suchen und Sortieren – die Klassen Collections und Arrays
-
-
11.7.5 Verkürzte Notation bei Collection-Datentypen
-
-
11.7.7 Assoziative Sammlungen mit Maps
-
11.7.7.1 Das Interface Map
-
11.7.7.2 Die Klassen HashMap und TreeMap
-
-
-
-
11.8 Die Klasse StringTokenizer
-
-
-
12 Aufbau grafischer Oberflächen in Frames – von AWT nach Swing
-
12.1 Grundsätzliches zum Aufbau grafischer Oberflächen
-
12.2 Ein einfaches Beispiel mit dem AWT
-
12.3 Let's swing now!
-
12.4 Etwas „Fill-in“ gefällig?
-
12.5 Die AWT- und Swing-Klassenbibliothek im Überblick
-
-
-
13 Swing-Komponenten
-
13.1 Die abstrakte Klasse Component
-
13.2 Die Klasse Container
-
13.3 Die abstrakte Klasse JComponent
-
13.4 Layout-Manager, Farben und Schriften
-
13.4.1 Die Klasse Color
-
13.4.2 Die Klasse Font
-
13.4.3 Layout-Manager
-
13.4.3.1 Die Klasse FlowLayout
-
13.4.3.2 Die Klasse BorderLayout
-
13.4.3.3 Die Klasse GridLayout
-
-
-
13.5 Einige Grundkomponenten
-
13.5.1 Die Klasse JLabel
-
13.5.2 Die abstrakte Klasse AbstractButton
-
13.5.3 Die Klasse JButton
-
13.5.4 Die Klasse JToggleButton
-
13.5.5 Die Klasse JCheckBox
-
13.5.6 Die Klassen JRadioButton und ButtonGroup
-
13.5.7 Die Klasse JComboBox
-
13.5.8 Die Klasse JList
-
13.5.9 Die abstrakte Klasse JTextComponent
-
13.5.10 Die Klassen JTextField und JPasswordField
-
13.5.11 Die Klasse JTextArea
-
13.5.12 Die Klasse JScrollPane
-
13.5.13 Die Klasse JPanel
-
-
13.6 Spezielle Container, Menüs und Toolbars
-
13.6.1 Die Klasse JFrame
-
13.6.2 Die Klasse JWindow
-
13.6.3 Die Klasse JDialog
-
13.6.4 Die Klasse JMenuBar
-
13.6.5 Die Klasse JToolBar
-
-
-
-
14 Ereignisverarbeitung
-
14.1 Zwei einfache Beispiele
-
14.1.1 Zufällige Grautöne als Hintergrund
-
14.1.2 Ein interaktiver Bilderrahmen
-
-
14.2 Programmiervarianten für die Ereignisverarbeitung
-
14.2.1 Innere Klasse als Listener-Klasse
-
14.2.2 Anonyme Klasse als Listener-Klasse
-
14.2.3 Container-Klasse als Listener-Klasse
-
14.2.4 Separate Klasse als Listener-Klasse
-
-
14.3 Event-Klassen und -Quellen
-
14.4 Listener-Interfaces und Adapter-Klassen
-
14.5 Listener-Registrierung bei den Event-Quellen
-
14.6 Auf die Plätze, fertig, los!
-
-
-
15 Einige Ergänzungen zu Swing-Komponenten
-
15.1 Zeichnen in Swing-Komponenten
-
15.1.1 Grafische Darstellung von Komponenten
-
15.1.2 Das Grafikkoordinatensystem
-
15.1.3 Die abstrakte Klasse Graphics
-
15.1.4 Ein einfaches Zeichenprogramm
-
15.1.5 Layoutveränderungen und der Einsatz von revalidate
-
-
15.2 Noch mehr Swing gefällig?
-
-
-
16 Parallele Programmierung mit Threads
-
16.1 Ein einfaches Beispiel
-
16.2 Threads in Java
-
16.2.1 Die Klasse Thread
-
16.2.2 Das Interface Runnable
-
16.2.3 Threads vorzeitig beenden
-
-
16.3 Wissenswertes über Threads
-
16.3.1 Lebenszyklus eines Threads
-
16.3.2 Thread-Scheduling
-
16.3.3 Dämon-Threads und Thread-Gruppen
-
-
16.4 Thread-Synchronisation und -Kommunikation
-
16.4.1 Das Leser/Schreiber-Problem
-
16.4.2 Das Erzeuger/Verbraucher-Problem
-
-
16.5 Threads in Swing-Anwendungen
-
16.5.1 Auf die Plätze, fertig, los!
-
16.5.2 Spielereien
-
16.5.3 Swing-Komponenten sind nicht Thread-sicher
-
-
-
-
17 Ein- und Ausgabe über I/O-Streams
-
17.1 Grundsätzliches zu I/O-Streams in Java
-
17.2 Dateien und Verzeichnisse – die Klasse File
-
17.3 Ein- und Ausgabe über Character-Streams
-
17.3.1 Einfache Reader- und Writer-Klassen
-
17.3.2 Gepufferte Reader- und Writer-Klassen
-
17.3.3 Die Klasse StreamTokenizer
-
17.3.4 Die Klasse PrintWriter
-
17.3.5 Die Klassen IOTools und Scanner
-
17.3.5.1 Was machen eigentlich die IOTools?
-
17.3.5.2 Konsoleneingabe über ein Scanner-Objekt
-
-
-
17.4 Ein- und Ausgabe über Byte-Streams
-
17.4.1 Einige InputStream- und OutputStream-Klassen
-
17.4.2 Die Serialisierung und Deserialisierung von Objekten
-
17.4.3 Die Klasse PrintStream
-
-
17.5 Streams im try-Block mit Ressourcen
-
17.6 Einige abschließende Bemerkungen
-
17.6.1 Das Paket java.nio
-
17.6.2 Das Paket java.nio.file
-
17.6.2.1 Das Interface Path und die Klasse Paths
-
17.6.2.2 Die Klasse Files
-
-
-
-
-
18 Client/Server-Programmierung in Netzwerken
-
18.1 Wissenswertes über Netzwerkkommunikation
-
18.1.1 Protokolle
-
18.1.2 IP-Adressen
-
18.1.3 Ports und Sockets
-
-
18.2 Client/Server-Programmierung
-
18.2.1 Die Klassen ServerSocket und Socket
-
18.2.2 Ein einfacher Server
-
18.2.3 Ein einfacher Client
-
18.2.4 Ein Server für mehrere Clients
-
18.2.5 Ein Mehrzweck-Client
-
-
-
-
19 Lambda-Ausdrücke, Streams und Pipeline-Operationen
-
19.1 Lambda-Ausdrücke
-
19.1.1 Lambda-Ausdrücke in Aktion – zwei Beispiele
-
19.1.2 Lambda-Ausdrücke im Detail
-
19.1.3 Lambda-Ausdrücke und funktionale Interfaces
-
19.1.4 Vordefinierte funktionale Interfaces
-
19.1.5 Anwendungen auf Datenstrukturen
-
19.1.6 Methodenreferenzen als Lambda-Ausdrücke
-
19.1.7 Zugriff auf Variablen aus der Umgebung innerhalb eines Lambda-Ausdrucks
-
-
-
19.2 Streams und Pipeline-Operationen
-
19.2.1 Streams in Aktion
-
19.2.2 Streams und Pipelines im Detail
-
19.2.3 Erzeugen von endlichen und unendlichen Streams
-
19.2.4 Die Stream-API
-
-
-
-
20 Blick über den Tellerrand
-
20.1 JShell für kleine Skripte
-
20.2 Das Java-Modulsystem
-
20.3 Bühne frei für JavaFX
-
20.4 Beginn einer neuen Zeitrechnung
-
20.5 Webprogrammierung und verteilte Systeme
-
20.6 Zu guter Letzt
-
Quellcodes
| 2.3 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 2.2 | |
| Uebung.java | Quelltext zu Aufgabe 2.2 |
| Aufgabe 2.3 | |
| lsg2_3.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 2.3 |
| 3.1.10 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 3.1 | |
| lsg3_1.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.1 |
| Aufgabe 3.2 | |
| lsg3_2.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.2 |
| Aufgabe 3.3 | |
| Berechnung_v1.java | Programm aus Aufgabe 3.3 mit Fehlern |
| Berechnung_v2.java | Programm aus Aufgabe 3.3 ohne Fehler |
| lsg3_3.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.3 |
| 3.2.6 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 3.4 | |
| DreiMalMeinName.java | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.4 |
| Aufgabe 3.5 | |
| Strukturuebung_v1.java | Quelltext mit Fehlern |
| Strukturuebung_v2.java | Quelltext nach Korrektur |
| lsg3_5.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.5 |
| 3.3.8 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 3.6 | |
| lsg3_6.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.6 |
| Aufgabe 3.7 | |
| lsg3_7.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.7 |
| Aufgabe 3.8 | |
| Aufgabe3_8.java | Beispielprogramm zu Aufgabe 3.8 |
| 3.4.6 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 3.10 | |
| NameUndAlter_v1.java | Quelltext zu Aufgabe Aufgabe 3.10 (Variante 1) |
| NameUndAlter_v2.java | Quelltext zu Aufgabe Aufgabe 3.10 (Variante 2) |
| Aufgabe 3.11 | |
| Plus.java | Quelltext aus Aufgabe 3.11 |
| lsg3_11.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.11 |
| Aufgabe 3.12 | |
| Aufgabe3_12.java | Quelltext zu Aufgabe 3.12 |
| lsg3_12.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.12 |
| Aufgabe 3.13 | |
| RundFehl.java | Quelltext zu Aufgabe Aufgabe 3.13 |
| Aufgabe 3.14 | |
| Raviolita.java | Quelltext aus Aufgabe 3.14 |
| lsg3_14.html | Beispiel-Programmausgabe zu Aufgabe 3.14 |
| Aufgabe 3.15 | |
| SekundenZerlegung_v1.java | Quelltext zu Aufgabe 3.15 (Variante 1) |
| SekundenZerlegung_v2.java | Quelltext zu Aufgabe 3.15 (Variante 2) |
| Aufgabe 3.9 | |
| lsg3_9.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.9 |
| 3.5.7 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 3.16 | |
| Aufgabe3_16.java | Quelltext zu Aufgabe 3.16 |
| lsg3_16.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.16 |
| Aufgabe 3.17 | |
| lsg3_17.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.17 |
| Aufgabe 3.18 | |
| BreakAndContinue.java | Quelltext zu Aufgabe 3.18 |
| lsg3_18.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.18 |
| Aufgabe 3.19 | |
| Aufgabe3_19.java | Quelltext zu Aufgabe 3.19 |
| Aufgabe 3.20 | |
| Schachbrett.java | Quelltext zu Aufgabe 3.20 |
| Aufgabe 3.21 | |
| ForSchrott.java | Quelltext zu Aufgabe 3.21 |
| lsg3_21.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.21 |
| Aufgabe 3.22 | |
| Falsch.java | Quelltext zu Aufgabe 3.22 |
| lsg3_22.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.22 |
| lsg3_23.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.23 |
| Aufgabe 3.23 | |
| Irgendwas.java | Quelltext zu Aufgabe 3.23 |
| Aufgabe 3.24 | |
| Dreieck.java | Quelltext zu Aufgabe 3.24 |
| Aufgabe 3.25 | |
| Quersumme2.java | Quelltext zu Aufgabe 3.25 |
| Aufgabe 3.26 | |
| Sternzeit.java | Quelltext zu Aufgabe 3.26 |
| Aufgabe 3.27 | |
| Zerlegung.java | Quelltext zu Aufgabe 3.27 |
| Aufgabe 3.28 | |
| Aufgabe 3.29 | |
| Zahlenreihe.java | Quelltext zu Aufgabe 3.28 |
| Zinseszins.java | Quelltext zu Aufgabe 3.29 |
| Aufgabe 3.30 | |
| Zahlenraten.java | Quelltext zu Aufgabe 3.30 |
| Aufgabe 3.31 | |
| Binaer.java | Quelltext zu Aufgabe 3.31 |
| Aufgabe 3.32 | |
| Tannenbaum.java | Quelltext zu Aufgabe 3.32 |
| Aufgabe 3.33 | |
| Befreundet.java | Quelltext zu Aufgabe 3.33 |
| Aufgabe 3.34 | |
| Wochentag.java | Quelltext zu Aufgabe 3.34 |
| Aufgabe 3.35 | |
| Ostern.java | Quelltext zu Aufgabe 3.35 |
| 4.1.11 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 4.1 | |
| lsg4_1.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 4.1 |
| Aufgabe 4.2 | |
| lsg4_2.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 4.2 |
| Aufgabe 4.3 | |
| TerminKalender.java | Quelltext zu Aufgabe 4.3 |
| Aufgabe 4.4 | |
| Sortierung.java | Quelltext zu Aufgabe 4.4 |
| Aufgabe 4.5 | |
| MagicSquare.java | Quelltext zu Aufgabe 4.5 |
| 4.2.8 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 4.6 | |
| AdressBuch_v4.java | Quelltext zu Aufgabe 4.6 (Teil 2 von 2) |
| Adresse_v2.java | Quelltext zu Aufgabe 4.6 (Teil 1 von 2) |
| Aufgabe 4.7 | |
| Referenzen.java | Quelltext aus Aufgabe 4.7 |
| lsg4_7.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 4.7 |
| 5.1.10 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 5.1 | |
| Tangens.java | Quelltext zu Aufgabe 5.1 (Variante 1) |
| TangensDeg.java | Quelltext zu Aufgabe 5.1 (Variante 2) |
| Aufgabe 5.2 | |
| Swap.java | Quelltext zu Aufgabe 5.2 |
| Aufgabe 5.3 | |
| lsg5_3.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 5.3 |
| 5.3.4 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 5.4 | |
| GrussWortErweitert.java | Quelltext zu Aufgabe 5.4 |
| Aufgabe 5.5 | |
| KommandozeilenTest.java | Quelltext zu Aufgabe 5.5 |
| Aufgabe 5.6 | |
| lsg5_6.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 5.6 (Überladung) |
| Aufgabe 5.7 | |
| MenueStarter.java | Quelltext zu Aufgabe 5.7 |
| 5.6 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 5.10 | |
| lsg5_10.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 5.10 |
| Aufgabe 5.11 | |
| Anordnen.java | Quelltext zu Aufgabe 5.11 |
| Aufgabe 5.12 | |
| Echolot.java | Quelltext zu Aufgabe 5.12 |
| Aufgabe 5.8 | |
| lsg5_8.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 5.8 |
| Aufgabe 5.9 | |
| lsg5_9.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 5.9 |
| 6.6 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 6.1 | |
| lsg6_1.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 6.1 |
| Aufgabe 6.2 | |
| lsg6_2.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 6.2 |
| Aufgabe 6.3 | |
| lsg6_3.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 6.3 |
| 7.6 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 7.1 | |
| Student_v1.java | Quelltext zu Aufgabe 7.1 |
| lsg7_1.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.1 |
| Aufgabe 7.10 | |
| TestStrecke.java | Quelltext zu Aufgabe 7.10 (alle Klassen in einer Datei) |
| Aufgabe 7.11 | |
| AchJa.java | Quelltext zu Aufgabe 7.11 (alle Klassen in einer Datei) |
| lsg7_11.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.11 |
| Aufgabe 7.12 | |
| Patient.java | Quelltext zu Aufgabe 7.12 |
| lsg7_12.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.12 |
| Aufgabe 7.15 | |
| lsg7_15.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.15 |
| Aufgabe 7.16 | |
| TesteTrinkGlas.java | Quelltext zu Aufgabe 7.16 (alle Klassen in einer Datei) |
| Aufgabe 7.2 | |
| Student_v2.java | Quelltext zu Aufgabe 7.2 |
| lsg7_2.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.2 |
| Aufgabe 7.3 | |
| KarlsruherStudent.java | Quelltext zu Aufgabe 7.3 (benötigt Student.java) |
| Aufgabe 7.4 | |
| lsg7_4.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.4 |
| Aufgabe 7.5 | |
| Hund.java | Quelltext zu Aufgabe 7.5 (alle Klassen in einer Datei) |
| lsg7_5.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.5 |
| Aufgabe 7.6 | |
| TestZwei.java | Quelltext zu Aufgabe 7.6 |
| lsg7_6.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.6 |
| Aufgabe 7.7 | |
| lsg7_7.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.7 |
| Aufgabe 7.8 | |
| TennisSpieler.java | Quelltext zu Aufgabe 7.8 |
| lsg7_8.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7.8 |
| Aufgabe 7.9 | |
| TestMensch.java | Quelltext zu Aufgabe 7.9 (alle Klassen in einer Datei) |
| Aufgaben 7.13 und 7.14 | |
| ReifenFahrzeugTest.java | Quelltext zu Aufgaben 7.13 und 7.14 (alle Klassen in einer Datei) |
| 8.1.7 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 8.1 | |
| DM.java | Quelltext zu Aufgabe 8.1 (Teil 2 von 5) |
| Euro.java | Quelltext zu Aufgabe 8.1 (Teil 4 von 5) |
| Franc.java | Quelltext zu Aufgabe 8.1 (Teil 3 von 5) |
| Lire.java | Quelltext zu Aufgabe 8.1 (Teil 1 von 5) |
| Waehrung.java | Quelltext zu Aufgabe 8.1 (Teil 5 von 5) |
| Aufgabe 8.2 | |
| WaehrungsKalkulator.java | Quelltext zu Aufgabe 8.2 (braucht die Dateien von Aufgabe 8.1) |
| 8.5 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 8.3 | |
| Euro.java | Quelltext zu Aufgabe 8.3 (Teil 1 von 3) |
| Lire.java | Quelltext zu Aufgabe 8.3 (Teil 3 von 3) |
| Waehrung.java | Quelltext zu Aufgabe 8.3 (Teil 2 von 3) |
| Aufgabe 8.4 | |
| InstanceOfTest.java | Quelltext zu Aufgabe 8.4 |
| lsg8_4.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8.4 |
| Aufgabe 8.5 | |
| WrapperClassTest.java | Quelltext zu Aufgabe 8.5 |
| lsg8_5.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8.5 |
| 8.10 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 8.12 | |
| Sandwich.java | Quelltext zu Aufgabe 8.12 (alle Klassen in einer Datei) |
| lsg8_12.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8.12 |
| Aufgabe 8.13 | |
| AutoTest.java | Quelltext zu Aufgabe 8.13 a) |
| ElchTest.java | Quelltext zu Aufgabe 8.13 b) |
| lsg8_13.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8.13 |
| Aufgabe 8.14 | |
| ABCD.java | Quelltext zu Aufgabe 8.14 |
| lsg8_14.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8.14 |
| Aufgabe 8.6 | |
| lsg8_6.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8.6 |
| Aufgabe 8.7 | |
| lsg8_7.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8.7 |
| Aufgabe 8.8 | |
| TestABC.java | Quelltext zu Aufgabe 8.8 a) |
| TestABCmod.java | Quelltext zu Aufgabe 8.8 c) |
| lsg8_8.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8.8 |
| Aufgabe 8.9 | |
| GelochtePlatte.java | Quelltext zu Aufgabe 8.9 (Teil 2 von 3) |
| MetallPlatte.java | Quelltext zu Aufgabe 8.9 (Teil 1 von 3) |
| TestPlatte.java | Quelltext zu Aufgabe 8.9 (Teil 3 von 3) |
| lsg8_9.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8.9 |
| Aufgaben 8.10 und 8.11 | |
| Bildschirm.java | Quelltext zu Aufgaben 8.10 und 8.11 |
| DSpiel.java | Quelltext zu Aufgabe 8.11 |
| DameFigur.java | Quelltext zu Aufgaben 8.10 und 8.11 |
| SpielFigur.java | Quelltext zu Aufgaben 8.10 und 8.11 |
| Aufgaben 8.15 und 8.16 | |
| Point.java | Quelltext zu Aufgaben 8.15 und 8.16 |
| RunStrecke.java | Quelltext zu Aufgabe 8.16 |
| Strecke.java | Quelltext zu Aufgaben 8.15 und 8.16 |
| 9.1.2 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 9.1 | |
| Problem.java | Quelltext zu Aufgabe 9.1 |
| lsg9_1.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 9.1 |
| 9.1.6 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 9.2 | |
| Exueb1.java | Quelltext zu Aufgabe 9.2 (Teil 1 von 7) |
| Exueb2.java | Quelltext zu Aufgabe 9.2 (Teil 2 von 7) |
| Exueb3.java | Quelltext zu Aufgabe 9.2 (Teil 3 von 7) |
| Exueb4.java | Quelltext zu Aufgabe 9.2 (Teil 4 von 7) |
| Exueb5.java | Quelltext zu Aufgabe 9.2 (Teil 5 von 7) |
| Exueb6.java | Quelltext zu Aufgabe 9.2 (Teil 6 von 7) |
| Exueb7.java | Quelltext zu Aufgabe 9.2 (Teil 7 von 7) |
| lsg9_2.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 9.2 |
| 9.2.2 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 9.3 | |
| lsg9_3.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 9.3 |
| 9.2.8 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 9.4 | |
| Exueb8.java | Quelltext zu Aufgabe 9.4 |
| lsg9_4.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 9.4 |
| Aufgabe 9.5 | |
| ExceptionTest.java | Quelltext zu Aufgabe 9.5 |
| lsg9_5.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 9.5 |
| 10.1.4 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 10.3 | |
| EsWarEinmal.java | Vorgegebener Quelltext zu Aufgabe 10.3 |
| EsWarEinmalLoesung.java | Quelltext zu Aufgabe 10.3 |
| Aufgaben 10.1 und 10.2 | |
| Fach.java | Quelltext zu Aufgaben 10.1 und 10.2 |
| Student.java | Quelltext zu Aufgabe 10.1 und 10.2 |
| StudentenTest.java | Vorgegebener Quelltext zu Aufgabe 10.1 |
| StudentenTest2.java | Vorgegebener Quelltext zu Aufgabe 10.2 |
| 10.2.9 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 10.4 | |
| TierKaefig.java | Vorgegebener Quelltext zu Aufgabe 10.4 |
| TierKaefigTest.java | Test-Quelltext zu Aufgabe 10.4 |
| lsg10_4.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 10.4 |
| Aufgabe 10.5 | |
| Tierleben.java | Vorgegebener Quelltext zu Aufgabe 10.5 |
| lsg10_5.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 10.5 |
| Aufgabe 10.6 | |
| RateMal.java | Vorgegebener Quelltext zu Aufgabe 10.6 |
| RateMalB.java | Quelltext zu Aufgabe 10.6 b) |
| lsg10_6.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 10.6 |
| Aufgabe 10.7 | |
| Konzert.java | Quelltext zu Aufgabe 10.7 |
| lsg10_7.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 10.7 |
| 10.3.3 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 10.8 | |
| Rechteck.java | Quelltext zu Aufgabe 10.8 |
| Aufgabe 10.9 | |
| RechteckSort.java | Quelltext zu Aufgabe 10.9 |
| 10.4.5 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 10.10 | |
| Hemd.java | Quelltext zu Aufgabe 10.10 |
| Hose.java | Quelltext zu Aufgabe 10.10 |
| Jeans.java | Quelltext zu Aufgabe 10.10 |
| Jeanshemd.java | Quelltext zu Aufgabe 10.10 |
| Kleidung.java | Quelltext zu Aufgabe 10.10 |
| Lederhose.java | Quelltext zu Aufgabe 10.10 |
| Seidenhemd.java | Quelltext zu Aufgabe 10.10 |
| Socke.java | Quelltext zu Aufgabe 10.10 |
| 10.5.4 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 10.11 | |
| Rechteck.java | Quelltext zu Aufgabe 10.11 |
| Aufgabe 10.12 | |
| RechteckSort.java | Quelltext zu Aufgabe 10.12 |
| 11.1.3 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.1 | |
| StringLaufzeit.java | Quelltext zu Aufgabe 11.1 |
| Aufgabe 11.2 | |
| VokalBearbeitung.java | Quelltext zu Aufgabe 11.2 |
| 11.2.5 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.3 | |
| GGT.java | Quelltext zu Aufgabe 11.3 |
| Aufgabe 11.4 | |
| Berechne.java | Quelltext zu Aufgabe 11.4 |
| 11.3.3 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.5 | |
| BigFakul.java | Quelltext zu Aufgabe 11.5 |
| Aufgabe 11.6 | |
| BinomialKoeffizient.java | Quelltext zu Aufgabe 11.6 |
| 11.3.7 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.7 | |
| Formel.java | Quelltext zu Aufgabe 11.7 |
| Aufgabe 11.8 | |
| BigNewton2.java | Quelltext zu Aufgabe 11.8 |
| 11.4.4 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.10 | |
| FestPunktFormatNeu.java | Quelltext zu Aufgabe 11.10 |
| Aufgabe 11.9 | |
| FestPunktFormat.java | Quelltext zu Aufgabe 11.9 |
| 11.5.5 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.11 | |
| StoppuhrNeu.java | Quelltext zu Aufgabe 11.11 |
| Aufgabe 11.12 | |
| Zukunft.java | Quelltext zu Aufgabe 11.12 |
| 11.6.2 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.13 | |
| Zeitansage.java | Quelltext zu Aufgabe 11.13 |
| 11.7.6 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.14 | |
| ZiehungDerLottozahlen.java | Quelltext zu Aufgabe 11.14 |
| Aufgabe 11.15 | |
| Sieb.java | Quelltext zu Aufgabe 11.15 |
| 11.7.8 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.16 | |
| FertigGerichte.java | Quelltext zu Aufgabe 11.16 |
| Aufgabe 11.17 | |
| BabyWoerter.java | Quelltext zu Aufgabe 11.17 |
| 11.8.1 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 11.18 | |
| WortVerzeichnis.java | Quelltext zu Aufgabe 11.18 |
| 12.6 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 12.1 | |
| FrameMitText.java | Quelltext zu Aufgabe 12.1 |
| ZweiFrames.java | Quelltext zu Aufgabe 12.1 |
| Aufgabe 12.2 | |
| TextFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 12.2 |
| 13.7 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 13.1 | |
| VierButtonFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 13.1 |
| Aufgabe 13.2 | |
| FarbigerVierButtonFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 13.2 |
| Aufgabe 13.3 | |
| NotenEingabe.java | Quelltext zu Aufgabe 13.3 |
| NotenEingabeNeu.java | Quelltext zu Aufgabe 13.3 |
| NotenEingabeTest.java | Quelltext zu Aufgabe 13.3 |
| Aufgabe 13.4 | |
| FrameMitTextFeldern.java | Quelltext zu Aufgabe 13.4 |
| TextFelderAuslesen.java | Quelltext zu Aufgabe 13.4 |
| Aufgabe 13.5 | |
| KalenderBlatt.java | Quelltext zu Aufgabe 13.5 |
| 14.7 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 14.1 | |
| DatumFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 14.1 |
| Aufgabe 14.2 | |
| DatumFrame2.java | Quelltext zu Aufgabe 14.2 |
| Aufgabe 14.3 | |
| FarbenFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 14.3 |
| Aufgabe 14.4 | |
| FarbenFrame2.java | Quelltext zu Aufgabe 14.4 |
| MausLauscher.java | Quelltext zu Aufgabe 14.4 |
| Aufgabe 14.5 | |
| RechenFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 14.5 |
| Aufgabe 14.6 | |
| EuroConverter.java | Quelltext zu Aufgabe 14.6 |
| EuroFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 14.6 |
| 15.3 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 15.1 | |
| Punkt.java | Quelltext zu Aufgabe 15.1 |
| Aufgabe 15.2 | |
| GeoObjekt.java | Quelltext zu Aufgabe 15.2 |
| Strecke.java | Quelltext zu Aufgabe 15.2 |
| Aufgabe 15.3 | |
| Dreieck.java | Quelltext zu Aufgabe 15.3 |
| Aufgabe 15.4 | |
| DrehPanel.java | Quelltext zu Aufgabe 15.4 |
| Aufgabe 15.5 | |
| DrehFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 15.5 |
| Aufgabe 15.6 | |
| DrehFrame2.java | Quelltext zu Aufgabe 15.6 |
| DrehPanel2.java | Quelltext zu Aufgabe 15.6 |
| SchwerDreieck.java | Quelltext zu Aufgabe 15.6 |
| 16.6 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 16.1 | |
| Konzertdatenbank.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 16.1 |
| Aufgabe 16.2 | |
| BessererWert.java | Quelltext zu Aufgabe 16.2 |
| EVTest4.java | Quelltext zu Aufgabe 16.2 |
| EVTest5.java | Quelltext zu Aufgabe 16.2 |
| Erzeuger.java | Quelltext zu Aufgabe 16.2 |
| ErzeugerVerbraucher.html | Lösungsvorschlag zu Aufgabe 16.2 |
| GuterWert.java | Quelltext zu Aufgabe 16.2 |
| Verbraucher.java | Quelltext zu Aufgabe 16.2 |
| Wert.java | Quelltext zu Aufgabe 16.2 |
| Aufgabe 16.3 | |
| ColorRunButton.java | Quelltext zu Aufgabe 16.3 |
| LaufFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 16.3 |
| 17.7 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 17.1 | |
| Kopiere.java | Quelltext zu Aufgabe 17.1 |
| Aufgabe 17.2 | |
| InOutTools.java | Quelltext zu Aufgabe 17.2 |
| Aufgabe 17.3 | |
| VokalWandel.java | Quelltext zu Aufgabe 17.3 |
| vokolo.dat | Eingabedatei für Aufgabe 17.3 |
| Aufgabe 17.4 | |
| BinOut.java | Quelltext zu Aufgabe 17.4 |
| 18.3 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Alle Aufgaben | |
| MyClient.java | Clientprogramm für alle Aufgaben |
| Aufgabe 18.1 | |
| CD-Archiv-Dateien.html | Textdateien für den CD-Server |
| CDServer.java | Quelltext zu Aufgabe 18.1 |
| CDVerbindung.java | Quelltext zu Aufgabe 18.1 |
| Aufgabe 18.2 | |
| EuroConverter.java | Quelltext zu Aufgabe 18.2 |
| EuroServer.java | Quelltext zu Aufgabe 18.2 |
| EuroThread.java | Quelltext zu Aufgabe 18.2 |
| SteuerDienst.java | Quelltext zu Aufgabe 18.2 |
| Aufgabe 18.3 | |
| ChatFrame.java | Quelltext zu Aufgabe 18.3 |
| TalkDienst.java | Quelltext zu Aufgabe 18.3 |
| TalkServer.java | Quelltext zu Aufgabe 18.3 |
| 19.1.8 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 19.1 | |
| Lambda1.java | Quelltext zu Aufgabe 19.1 |
| Aufgabe 19.2 | |
| Lambda2.java | Quelltext zu Aufgabe 19.2 |
| 19.2.5 Übungsaufgaben | |
|---|---|
| Aufgabe 19.3 | |
| Pipeline1.java | Quelltext zu Aufgabe 19.3 |
| Aufgabe 19.4 | |
| Pipeline2.java | Quelltext zu Aufgabe 19.4 |
| Aufgabe 19.5 | |
| Pipeline3.java | Quelltext zu Aufgabe 19.5 |
Erzeugt am: Tue Jul 23 17:04:54 CEST 2024